In der „Hamburger Edition“ des Hamburger Instituts für Sozialforschung ist dieser Tage die deutsche Übersetzung des Buches „Blogistan. Politik und Internet im Iran“ erschienen. Ich habe für diese Ausgabe ein Vorwort beisteuern dürfen, das ich mit freundlicher Erlaubnis des Verlags hier ebenfalls veröffentlichen kann.
Im Mai 2011 fand erstmals im Vorfeld einer G8-Tagung auch ein „eG8-Gipfel“ statt. Der französische Präsident Sarkozy hatte Größen der Internetbranche wie Mark Zuckerberg (Facebook), Jeff Bezos (Amazon) oder Eric Schmidt (Google), aber auch Vordenker wie Yochai Benkler (Harvard University) oder John-Perry Barlow (Electronic Frontier Foundation) eingeladen, um über die Bedeutung des Internets für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu sprechen. Dabei wurde immer wieder auf die Revolutionen in Nordafrika verwiesen: War die Welt zu Beginn des Jahres nicht (erneut) Zeuge geworden, wie in Tunesien oder Ägypten digitale Informations- und Kommunikationstechnologien den sozialen Wandel nicht nur schleichend und schrittweise, sondern rasant und disruptiv vorantreiben?
Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass Medien immer eine wichtige Rolle für gesellschaftliche Veränderungen und politische Umstürze spielen: In der französischen Revolution des späten 18. Jahrhunderts waren das sich entwickelnde Zeitungswesen, aber auch Flugblätter, Vignetten und Karikaturen entscheidende Träger von Öffentlichkeit. In der Februarrevolution von 1917 spielte die Kontrolle über die Telegraphenleitungen eine wichtige Rolle bei der Koordination und Mobilisierung im riesigen russischen Reich. Die iranische Revolution von 1979 hingegen konnte auf Transistorradios und Kassettenrekorder zurückgreifen, um die Predigten und Aufrufe der Mullahs in der Bevölkerung zu verbreiten.
Heute, im Jahr 2011, spricht man von „Facebook-Revolutionen“ oder „Twitter-Revolutionen“ – die Werkzeuge, um Öffentlichkeit für politische Forderungen herzustellen, Gleichgesinnte zu mobilisieren und Aktivitäten zu koordinieren, haben sich ganz offensichtlich weiter entwickelt. Die Verbreitung von Mobiltelefonen und digitalen Kameras erhöht die Chance, dass Bilder von Demonstrationen, Protesten oder Übergriffen aufgezeichnet werden. Netzwerkplattformen, Blogs und Microblogs senken die Hürden weiter, diese Informationen dann auch nahezu in Echtzeit zu verbreiten. Die Schneeballeffekte, die in den vernetzten Öffentlichkeiten zum Tragen kommen, erhöhen die Reichweite der Bilder und Aufrufe – auch weil etabliert-professionelle Medien auf solche nutzergenerierten Inhalte zurückgreifen und in ihre eigene Berichterstattung einbinden. So entstand anlässlich der Ereignisse in Nordafrika eine transnationale Öffentlichkeit. Jeder, der wollte, konnte buchstäblich „live“ die Proteste auf dem Tahrir-Platz in Kairo oder dem Platz des 7. November in Tunis verfolgen und sich unter Umständen sogar selbst als Multiplikator fühlen, zum Beispiel durch das Weiterleiten von Informationen zum Umgehen von Internetsperrungen. Diese Form der politischen Teilhabe auch über Grenzen hinweg war in der Tat neu. Doch rechtfertigt sie es, von einer „Internet-Revolution“ zu sprechen? Die Einschätzungen von westlichen Beobachtern wie von Beteiligten vor Ort decken sich darin, dass die Ursache der Proteste nicht in den digitalen Technologien zu suchen sind, sondern in Faktoren wie hoher Jugendarbeitslosigkeit, grassierender Korruption oder steigenden Preise. Zudem wird zu Recht darauf hingewiesen, dass das Internet nicht per se demokratisch ist, auch wenn „Cyberoptimisten“ gerne eine quasi natürliche Verbindung zwischen dessen dezentralen technischen Architektur und demokratisierenden Wirkungen unterstellen.
Man muss aber nicht gleich ins andere Extrem des „Cyberpessimismus“ fallen um zu erkennen, dass die gleichen Technologien auch für Überwachung und Kontrolle, für Propaganda oder Zensur eingesetzt werden. Zudem gilt es zumindest zu bedenken, dass viele der Plattformen und Werkzeuge, mit deren Hilfe sich demokratische Öffentlichkeiten online formieren und artikulieren, im Grunde hochgradig kommerzialisiert sind: Sie werden von Unternehmen zur Verfügung gestellt und betrieben – für Nutzer, die nicht „Bürger“, sondern „Kunden“ sind und daher nur eingeschränkte Mitspracherechte (wenn überhaupt) bei der Gestaltung und Kontrolle der Kommunikationsräume haben, in denen sie sich über Persönliches wie Politisches austauschen.
Das Verhältnis von Internet und Politik ist also durchaus komplexer, als technikzentrierte Perspektiven, ob nun optimistisch oder pessimistisch, nahelegen. Dies liegt erstens daran, dass „das Internet“ als Analysekategorie schlechterdings ungeeignet, weil deutlich zu grob ist. Es vereint auf einer technischen Grundlage – verteilten Netzwerken von Rechnern, die auf der Basis spezifischer Protokolle Daten austauschen – eine Vielzahl von Kommunikationsdiensten, Angeboten und Plattformen, die je eigene Optionen eröffnen und Kommunikationsmodi unterstützen. Als Hybrid- oder Universalmedium stellt es Kanäle der interpersonalen one-to-one-Kommunikation (z.B. die E-Mail) genauso zur Verfügung wie es Formen der massenmedialen Kommunikation unterstützt, seien es Livestreams von Radio- oder Fernsehsendern oder die publizistischen Angebote von Online-Zeitungen. Hinzu kommen vielfältige Varianten der gruppen- oder netzwerkbezogenen Kommunikation, die sich auf Netzwerkplattformen, in Diskussionsforen oder Chatrooms äußert. Und nicht zuletzt bieten Onlinetechnologien interaktive Funktionen, die eher in den Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion fallen, beispielsweise Recherchen in Datenbanken und Archiven, spielerische Tools zur Ermittlung von politischen Präfenzen wie den Wahlomaten, oder Werkzeuge zur Abwicklung und Unterstützung von Transaktionen, Abstimmungen oder gar dem Online-Voting.
Zweitens: Welche tatsächlichen Folgen diese kommunikationstechnisch ganz unterschiedlich gestalteten Angebote für politisches Handeln entfalten, hängt von ihrer Einbettung in existierende institutionelle oder organisatorische Strukturen ab, die jeweils eigene Prägekraft einbringen. So agieren in einzelnen Politikfeldern ganz unterschiedliche kollektive Akteure, darunter Parteien, lokale Bürgerinitiativen, Nichtregierungsorganisationen o.ä., mit jeweils eigenen Zielen und Interessen, institutionalisierten Formen der Koordination und Abstimmung von Handeln sowie des Austragens von Konflikten, nicht zuletzt auch mit unterschiedlichen personellen oder finanziellen Ressourcen. In diesen existierenden Rahmen werden die neuen Technologien eingepasst – ob sie an die Seite oder an die Stelle anderer Werkzeuge und Technologien treten, ist aber nicht von vorneherein ausgemacht.
Werden diese Kontextbedingungen für onlinebasierte politische Kommunikation außer Acht gelassen, kommt es in aller Regel rasch zu Fehlschlüssen, wie sich exemplarisch am Umgang mit der vielbeachteten Online-Strategie des 2008er-Präsidentschaftswahlkampfs von Barack Obama zeigen lässt. Diese beruhte zu wesentlichen Teilen darauf, mit Hilfe von digitalen Plattformen lokale Unterstützernetzwerke zu initiieren (indem Gleichgesinnte vor Ort zusammengebracht wurden), deren Basisarbeit zu unterstützen (indem Wahlkampfmaterial und Argumentationshilfen, aber auch Adressen noch unentschlossener Wähler für Hausbesuche zur Verfügung gestelllt wurden) und nicht zuletzt bis dato ungekannte Summen an (Klein-)Spenden einzuwerben – mit denen ja ironischerweise massiv Werbeplätze im Fernsehen gekauft werden konnten.
Diese Strategie auf Deutschland zu übertragen scheiterte nicht an der Unwilligkeit oder Unkenntnis auf Seiten deutscher Wahlkämpfer (auch wenn Abneigungen gegen das Netz existieren mögen), sondern vielmehr daran, dass es hierzulande die Unterstützerwerke bereits, manche würden sagen: noch gibt: Es sind die Ortsvereine oder Bezirksgruppen der Parteien, die Engagement bündeln und auf eine stabile organisatorische Basis stellen, zudem auch zwischen den Wahlkämpfen aktiv sind. Durch das System der staatlichen Parteienfinanzierung in Kombination mit Mitgliedsbeiträgen sind Parteien und ihre Kandidaten darüber hinaus nicht im gleichen Maße darauf angewiesen, jeden Wahlkampf von Grund auf neu durch Spenden zu finanzieren.
Die Wechselwirkungen zwischen Internet und Politik sind schließlich komplex, weil sie drittens in umfassendere medial-kulturelle Konstellationen eingebettet sind, die aus – je nach Gesellschaft oder Subkultur, Szene oder Gemeinschaft unterschiedlichen – Formen und Praktiken der sozialen Organisation und des Verhältnisses von Indidivuum zum Kollektiv bestehen. Online-Plattformen wie Twitter oder Facebook in Kombination mit mobilen Endgeräten unterstützen eine spezifische Morphologie der sozialen Organisation, die sich mit dem kanadischen Soziologen Barry Wellman als „networked individualism“ oder „vernetzte Individualität“ bezeichnen lässt: Der Einzelne ist im Lebensverlauf beständig gefordert, seine individuelle Identität beständig und aktiv herzustellen und anderen zu signalisieren, weil traditionelle Vorgaben und Bindungen an Bedeutung verlieren. Dies geschieht zunehmend in lockeren, zeitlich flexiblen und örtlich weit reichenden Beziehungsgeflechten, die netzwerkartig organisiert sind, also nicht mehr so klar abgrenzbar sind wie beispielsweise die gesellschaftlichen Stände der Vormoderne oder die großen gesellschaftlichen Milieus des 20. Jahrhunderts. Digitale Technologien helfen, diese Anforderungen an die Gestaltung des eigenen Lebens zu bewältigen und bestärken diese dadurch gleichzeitig.
Doch diese Form von Sozialität, die gerade das Web 2.0 fördert und fordert, beinhaltet eben auch ein spezifisch westlich-modernes Verständnis des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft, das z.B. in Asien oder Nordafrika auf andere, kulturell-historisch verschieden geprägte Formen trifft, ob nun religiös, ethnisch, familial oder lokal geprägt. Inwieweit sich solche Formen von Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung behaupten können, sich – auch angesichts anderer tiefgreifender Veränderungen wie anhaltende Verstädterung oder ökonomische Globalisierung – wandeln oder aber sich die Sozialmorphologie des vernetzten Individualismus durchsetzt, ist nicht klar. Für das Verhältnis von Internet und Politik ist dies deswegen relevant, weil einerseits das dominierende Menschen- und Gesellschaftsbild auch die Grundlage für die Organisation von kollektiver Willensbildung und gesellschaftlichem Wandel darstellt. Andererseits werden die damit zusammenhängenden kulturellen, politischen und ökonomischen Konflikte um die Gestalt der „Weltgesellschaft“ eben auch mit Hilfe des Internets, in digitalen und (potentiell) globalen Öffentlichkeiten ausgetragen.
Es ist daher nur zu begrüßen, wenn sich Studien umfassend mit der gesellschaftlichen Verbreitung und Aneignung digitaler Technologien befassen. Das vorliegende Buch stellt ein hervorragendes Beispiel einer solchen fundierten Analyse dar. Es widmet sich dem Iran – einem Land, das vor den Ereignissen in Nordafrika gerne als Beispiel für die Potentiale des Internets herangezogen wurde. Die Proteste nach der Präsidentschaftswahl vom Sommer 2009 wurden ebenfalls über internetbasierte Plattformen wie YouTube, Flickr oder Blogs über die Grenzen des Landes getragen. Die Studie „Blogistan“ macht diese Ereignisse verständlich, indem es aus einer breiteren Perspektive die Entwicklung und gesellschaftliche Verbreitung von Informations- und Kommunikationstechnologien im Allgemeinen und von Weblogs im Speziellen im Iran skizziert und in den gesellschaftlichen sowie politischen Kontext einbettet.
Es liefert insbesondere Einblicke in die Vielfalt und die historische, kulturelle und politische Bedeutung iranischer Blogs. Deren Popularität lässt sich nicht allein auf den Wunsch nach freier Meinungsäußerung in einem repressiven Staat zurückzuführen, denn dann müssten in anderen arabischen Ländern oder auch in China deutlich mehr Blogger existieren. Vielmehr zeigen die Autoren auf, wie verschiedene Faktoren die iranische Blogosphäre prägen: Das im kollektiven Gedächtnis verankerte Erbe der Revolution, die alltäglichen repressiven Erfahrungen der Bürger, kulturelle Muster des (auch künstlerischen) Ausdrucks sowie die Vorstellungen von Kosmopolität die im Iran wie in der großen iranischen Diaspora verbreitet sind.
Die Studie öffnet zudem auch den Blick für erweiterte Formen der Teilhabe und des Politischen, die im Iran z.B. im Zwischen-den-Zeilen eines Poesieblogs oder der Diskussion scheinbar privat-persönlicher Eindrücke einer jungen Frau über ihren Alltag stecken. So trägt es auch zu einer differenzierteren Einschätzung der iranischen Gesellschaft bei; letztlich lässt es sich nämlich auch als Studie des Wandels von gesellschaftlich-kulturellen Strukturen des Iran durch die Linse der Medienentwicklung lesen.
Eine solche differenzierte Analyse hilft, den „western bias“ überwinden, der in vielen Analysen der gesellschaftlichen Auswirkungen neuer Medientechnologien zu finden ist: Aneignung, Verbreitung und Konsequenzen gerade des Web 2.0 werden zumeist unter (implizitem) Rückgriff auf die amerikanische Gesellschaft diskutiert, anstatt die jeweilige kulturelle Einbettung der Technologien angemessen zu berücksichtigen. Das betrifft nicht nur den bereits erwähnten Vergleich der Online-Wahlkämpfe in den USA und Deutschland, sondern insbesondere auch Debatten um weiterführende gesellschaftliche Fragen wie die Vorstellung von Privatsphäre oder die Struktur der grenzüberschreitenden Internetökonomie, bei denen leider oft der Blick über den westlichen Tellerrand fehlt.
Dieses Buch ist also deswegen so verdienstvoll, weil es deutlich macht, dass Technologien eben nicht einfach so „wirken“, sondern ihre Nutzung, ihre Folgen und ihre kulturelle Signifikanz immer vom jeweiligen gesellschaftlichen Kontext abhängen – ohne jedoch kulturalistischen Determinismus an die Stelle des technologischen Determinismus zu setzen. Das Buch ist somit mehr als „nur“ eine Studie zu Weblogs im Iran, sondern vielmehr auch eine umfangreiche Abhandlung der Auswirkungen und Eingebettetheit neuer Medien auf und in gesellschaftliche Strukturen und politische Prozesse.
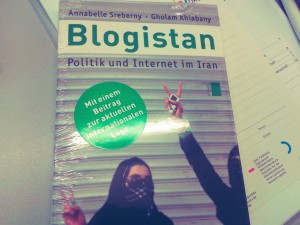
Ein Kommentar